Türen öffnen im Advent
In der Dämmerung durch die Straßen zu spazieren ist im Advent besonders schön. Über der Hauptstraße sind Lichterketten aufgespannt, in vielen Fenstern der alten Häuser scheint Licht. Warm und heimelig sieht das aus.

Vor allem die Haustüren haben es mir angetan. Vor manchen bleibe ich stehen, weil sie so schön geschmückt sind. Tannenbäume stehen da, hölzerne Sterne, schön gebundene Kränze. Langsam gehe ich weiter von Haus zu Haus, von Tür zu Tür. Als ich wieder bei mir Zuhause ankomme, warte ich noch einen Moment und schaue. Auch hier brennt Licht, das durch ein Fenster aus mattem Glas fällt. Der helle Schein erleuchtet ein Muster. Ich staune, wie schön das aussieht.
Die Türen der Häuser sind so unterschiedlich und einzigartig wie die Menschen, die in ihnen wohnen. Ich kenne längst nicht alle. Den meisten Hausbewohnern werfe ich einen flüchtigen Gruß zu, wenn ich ihnen begegne. Manchmal ergibt sich ein Gespräch.
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ singen wir im Advent. Für mich ist der Advent eine Zeit, in der sich Türen öffnen. Bei den vielen Adventsfeiern, wenn eigentlich jeder sich Zeit nimmt, um anderen zu begegnen.
Türen in Stockstadt öffnen sich auch für den Besuchsdienst der evangelischen Kirchengemeinde. Mehr als 200 ältere und kranke Leute im Ort werden besucht und erhalten ein kleines Geschenk. Wichtiger noch ist, dass jemand mal nachfragt wie es so geht, zuhört, Mut macht, ein Lächeln schenkt.
Advent ist die Zeit, in der sich nicht nur Türen öffnen, sondern auch Menschenherzen – für Gott und füreinander.
Pfarrerin Ksenija Auksutat
„In der Heiligen Nacht
möge Frieden Dein Gast sein
und das Licht der Weihnachtskerzen
weise dem Glück den Weg zu Deinem Haus.“
Irischer Segensspruch
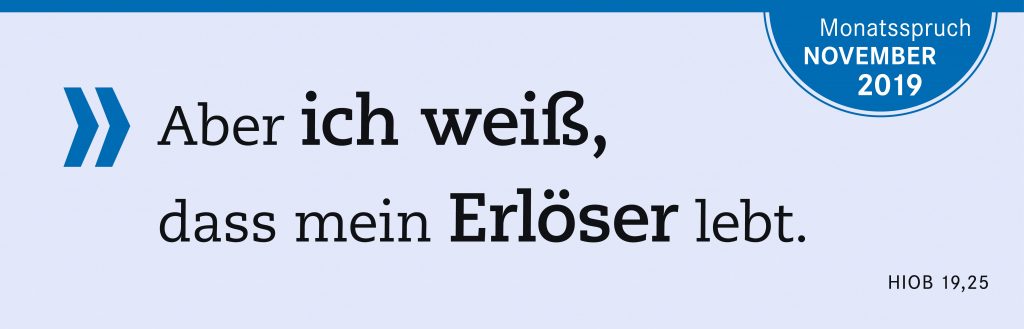
Am Ende steht die Zuversicht
Hiob hat alles verloren: seine Töchter und Söhne, dazu das, was er besaß. Nun breiten sich auch noch auf seinem Körper Geschwüre aus. Viele Menschen machen einen Bogen um ihn. Drei Freunde aber kommen und stehen ihm bei. Sieben Tage lang schweigen sie mit ihm. Ich stelle mir vor, wie gut das tut. Keine Erklärungsversuche, kein billiger Trost. Nur Aushalten. Schweigen da, wo Worte nicht reichen. Sieben Tage lang.
Dann aber meint einer, nun müsse doch endlich die Ursache für solch ein Unheil geklärt werden. Alle drei weisen nun Hiob die Schuld zu. Sein Leiden sei eine Strafe Gottes. Hiob aber wehrt sich energisch. Nein, sagt er, andersherum sei es: Gott habe ihm Unrecht getan. Er wütet und tobt. Er ringt mit den Freunden und zugleich mit Gott. Doch dann schlägt er einen anderen Ton an: „Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt“, ruft er. Ob diese Wende sich erst vollziehen kann, nachdem alles andere ausgesprochen ist und Hiob Wut, Klage und Verzweiflung zum Himmel schreit?
Hiob zeigt mir: In den schwarzen Zeiten meines Lebens muss ich nicht immer glaubensstark sein. Ich darf zweifeln, klagen, anklagen und fluchen. Gott hält das aus. Nicht er bringt Unheil über mich, schon gar nicht, um mich zu strafen. Die Frage nach dem „Warum“ muss und darf also offenbleiben. Um des Menschen und um Gottes willen.
„Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ Dass am Ende diese Zuversicht stehen darf, darum bitte ich.
Tina Willms
„Der Gemeindebrief“

Riskiere deinen Reichtum
Ein Mädchen macht es vor: Aus Mitleid verschenkt es alles, was es hat. Einem Hungrigen gibt es sein letztes Brot, einem Kind, das friert, schenkt es die Mütze, dem nächsten das Röckchen, und schließlich gibt es das letzte Hemd. Wohl nicht zufällig erzählt die Geschichte von einem Kind. Als Erwachsene spüre ich: Irgendwann spaziert die Angst ins Leben, nistet sich ein und macht sich breit: Hast du wirklich genug? fragt sie. Wird es denn reichen, was dir zur Verfügung steht? Zuerst Geld und Brot, Kleidung und Wärme? Dann aber auch Zeit, Kraft, Sinn und Lebendigkeit?
Gut, wenn einer die Sorgen ernst nimmt, die ich mir mache. Besser noch: wenn er nicht dabei stehen bleibt. Sondern mir Mut macht, etwas zu wagen: Verschenke von dem, was du hast, und zwar nicht nur von dem, was im Überfluss da ist. Sondern auch von dem, um das du dich sorgst. Riskiere deinen Reichtum und setz dich selber aufs Spiel.
Einfach ist das nicht. Ich könnte anfangen mit dem, wovon ich mehr als genug habe. Und dann mutiger werden und von dem geben, um das ich mich sorge. Vielleicht erfahre ich: Es ist mehr da als geglaubt. Und es bereichert mich, warmherzig und mitfühlend zu sein.
Vielleicht geschieht gar, was sonst nur im Märchen möglich scheint, wo dem Mädchen am Ende glänzende Sterntaler in den Schoß fallen. Vielleicht fliegt auch mir vom Himmel etwas zu, auf das ich gar nicht aus war: Freundschaft oder Verwegenheit, Glück oder Lebenssinn.
Tina Willms
„Der Gemeindebrief“
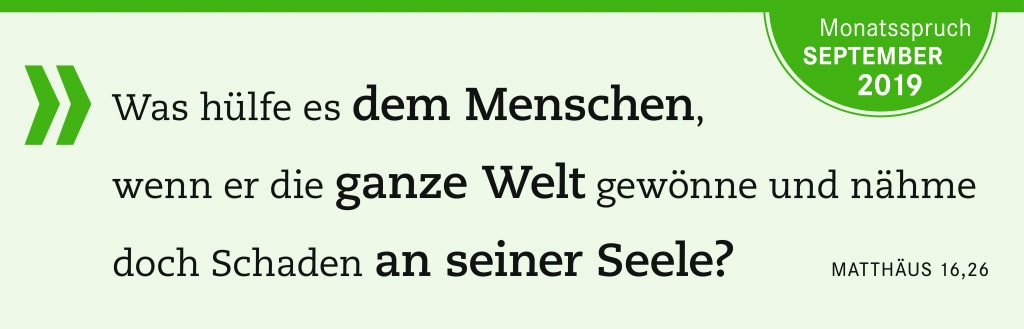
Eigene Grenzen erkennen
Wie wäre es, wenn ich mein Leben völlig grenzenlos gestalten könnte? Was würde ich tun? Was würde ich verändern? Klingt das nicht verlockend? Wäre das nicht ein Traum?
Ich könnte mich dann auf dieser Erde völlig frei bewegen, sozusagen durch Raum und Zeit schweben. Ich könnte die Nacht zum Tag machen und umgekehrt, Krankheiten ausmerzen, den Hunger besiegen, der Umweltzerstörung ein Ende setzen. Ich könnte das Leben verlängern, so lange ich wollte, könnte alles erwerben, was mir gefällt. Es gäbe weder Gut noch Böse, denn ich selbst wäre das Maß aller Dinge. Allerdings dürfte ich niemals zweifeln oder in Frage stellen, was ich tue. Ich müsste es durchziehen, auch ohne zu wissen, was am Ende dabei herauskommt.
Aber wäre das nicht egal? Wenn ich doch in der Hand hätte, was geschieht, könnte ich ja verändern, wann und was ich wollte. Es würde keine Rolle spielen, wenn mal etwas danebengeht. Vielleicht.
Vielleicht aber würde diese Illusion der totalen Machbarkeit doch schnell zum Alptraum. Würde ich das aushalten? Denn: Niemand stünde mir zur Seite mit einem hilfreichen Rat oder einer Frage oder einer Grenze. Niemand würde sagen: Stopp, das geht zu weit, das tut nicht gut.
Würde mich die totale Möglichkeit nicht wie ein Tsunami überrollen und hinwegspülen? Meine engen Grenzen sind dann vielleicht doch zu guter Letzt meine Rettung.
Nyree Heckmann
„Der Gemeindebrief“

Der Himmel öffnet Räume
Es ist soweit. Der Auftrag ist erteilt. Jetzt gelten keine Ausreden mehr und Weglaufen macht auch keinen Sinn. Jetzt muss ich Rede und Antwort stehen, mich in die Verantwortung nehmen lassen. Sozusagen das Wort unter die Füße nehmen und es zu den Menschen bringen.
Jetzt wird sichtbar werden, ob das von mir gesprochene Wort nur etwas verspricht, oder auch etwas verändert. Es muss nicht immer das ganz Große sein, auch ein klein wenig Veränderung gilt. Jetzt wird sichtbar werden, ob mein Gerede nur eine Wortblase ist, die zwar zum Himmel aufsteigt, dann aber auf Nimmerwiederhören verpufft. Oder ob es hilft, dass der Himmel zur Erde kommt: Damit der Sehnsuchtsort nicht in der Ferne bleibt, sondern zum Greifen nahe ist. Damit der heruntergekommene Himmel zwischen den Menschen einen Raum eröffnet, in dem sie sein dürfen, wie sie sind: krank, tot, aussätzig, boshaft.
Der Auftrag heißt: Rede mit ihnen, aber: Versprich ihnen nicht das Blaue vom Himmel herunter. Das wird sie verjagen, früher oder später, das bringt nichts. Aber mit ihnen um das Leben ringen, es dem Tod abtrotzen, es der Krankheit entreißen, ja auch der Boshaftigkeit. Das könnte gehen. An ihrer Seite, und zwar gemeinsam, da, wo es möglich ist. Und wenn es nicht geht – ja, das gibt es eben auch –, dann nicht darum herumreden, sondern loslassen. Abschied nehmen, sein lassen. Aber das dann um Himmels willen hier auf Erden!
Nyree Heckmann
„Der Gemeindebrief“
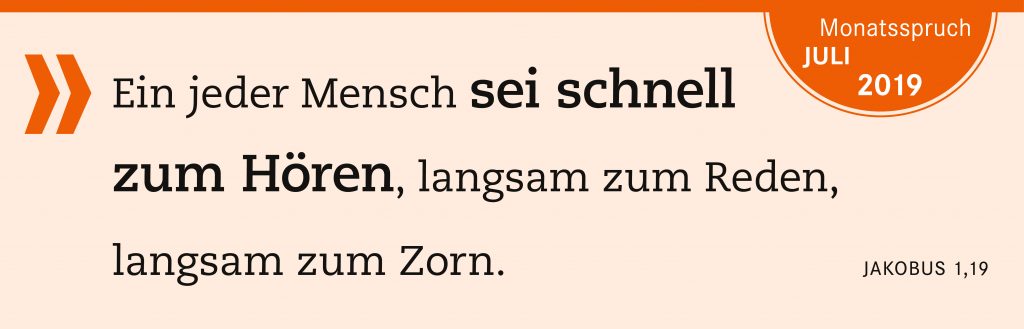
Gedanken reifen lassen
Geduld ist nicht gerade meine Stärke. Manchmal ärgere ich mich über mich selbst, wenn ich jemandem ins Wort falle oder nicht abwarten kann und einfach zugreife und lieber alles selbst mache. Dann geht es wenigstens schnell, denke ich. Damit entmutige ich Kinder, stoße Erwachsene vor den Kopf.
Das Zitat aus dem Jakobusbrief sollte für mich und gewiss auch für viele andere Zeitgenossen täglicher Begleiter sein. Es klingt so einfach: Hör genau hin, überleg dir deine Worte, sei doch nicht gleich so aufbrausend!
Die Hektik unserer Zeit ist keine Entschuldigung für vorschnelle Aktionen und heftige Reaktionen. Stellen Sie sich Jesus bei der Bergpredigt vor, kaum hätte er einen Satz zu Ende gesagt, gäbe es schon Sprechchöre und wütende Angriffe. Was wäre uns da verloren gegangen, hätten Menschen nicht zugehört und in Ruhe Fragen gestellt und manchmal einfach nur gute Worte und Ideen weitergegeben.
Hör doch bitte erst einmal hin, sortiere deine Gedanken, überlege genau, was du wie sagen willst und ball nicht gleich die Faust, wenn dir etwas nicht passt!
Geduld ist sicherlich nicht meine Stärke, genau hinzuhören habe ich aber inzwischen gelernt und Zornesfalten weitgehend verbannt. Das ist nicht nur eine Frage des Lebensalters oder des Berufes. Ich bin mir sicher: Die Lebens- und Glaubenserfahrung haben mich gelehrt, auf die Weisheit der Bibel zu hören. Sie trägt sehr gut im Alltag.
Carmen Jäger
„Der Gemeindebrief“
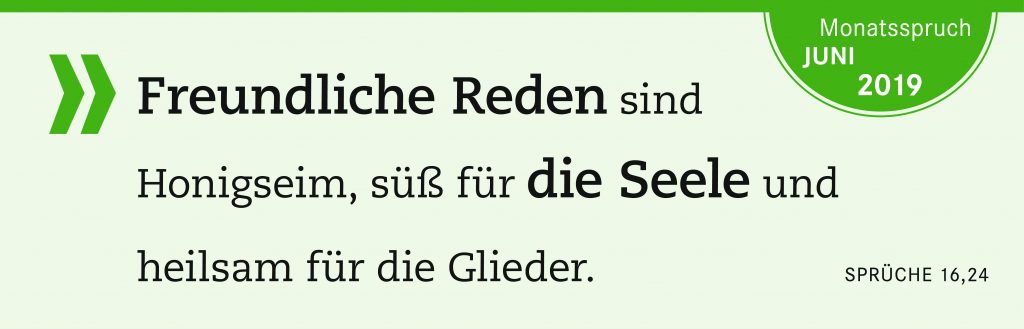
Gute Worte sind eine Wohltat
Unsere Sprache wird immer aggressiver und härter, fordernder und lauter. Brüllen hat Einzug in die gute Stube gehalten. Sogar in politischen Auseinandersetzungen sind Beschimpfungen an der Tagesordnung. In Schulen und Kindergärten spiegeln sich diese Verhaltensmuster wider. Gleichgültigkeit vor der äußeren und inneren Not eines Menschen geht quer durch alle Schichten der Gesellschaft.
Wie wunderschön dagegen dieser Satz aus dem Alten Testament: Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele und heilsam für die Glieder. Schließen wir doch mal die Augen und schmecken ihm nach – ein sonniger Morgen, knusprige Brötchen mit Butter und Honig, dazu duftender Kaffee oder goldgelber Tee. Manch dunkler Schatten der Nacht, manch Schmerz in den Knochen verschwindet zwar nicht, wird aber zweitrangig.
Ein freundliches Wort kann ich nicht mit finsterem Gesicht sagen, und mit einem Lächeln im Gesicht kann ich nicht aggressiv werden. Körper und Seele gehören zusammen: unsere Sprache ist Ausdruck unserer körperlichen und seelischen Verfassung.
Ohne ein gutes Wort, ohne einen freundlichen Blick geht es mir schlecht. Und komischerweise trifft das nicht nur auf die Worte zu, die mir gesagt werden. Ich fühle mich auch sehr viel wohler, wenn ich lächeln kann und aufmunternde Worte für andere Menschen übrig habe. Vom Nektar der göttlichen Wegweisung zehre ich.
Carmen Jäger
„Der Gemeindebrief“

David hat hochfliegende Pläne. Er will für seinen Gott ein Haus bauen, wie es noch keiner gesehen hat. Und womöglich wünscht er sich, so auch selber Geschichte zu schreiben. Doch Davids kluger Berater Nathan sieht in einem Traum, dass diese Pläne zu groß sind. Ein anderer wird das Projekt fertig machen müssen. David erkennt das an und lobt Gottes Größe.
Hochfliegende Pläne: der Treibstoff des Lebens. Ich brenne für eine Idee oder bin begeistert von einem Projekt. Wie schön wäre es, etwas groß zu machen und mir selbst einen Namen. Aber dann kommt etwas dazwischen. Steine liegen im Weg. Ich komme an die Grenzen meiner Kraft. Und ich muss eingestehen: Was ich mir vorgenommen habe, ist zu groß für mich, ich schaffe es nicht. Vielleicht gehört das zu den schwierigsten Aufgaben des Lebens: die eigenen Grenzen erkennen, Pläne loslassen – und dann das erträumte Bild von mir deckungsgleich zu machen mit einem, das mich zeigt, wie ich bin. Das macht mich zunächst traurig. Aber – viel später – auch demütig und dankbar.
Denn es ist so befreiend, nicht mehr den Plänen hinterherjagen zu müssen, an denen ich mich nur verheben und scheitern kann. Es ist so erlösend, mir sagen zu lassen, dass ein anderer es fertig machen wird. Er, der ist wie sonst keiner, dessen Name weiter reicht als meine Kraft und mein Leben: Er fragt nicht nach dem, was ich vorzuweisen habe. Und schreibt meinen Namen doch groß in das Buch seines Lebens.
Tina Willms
„Der Gemeindebrief„
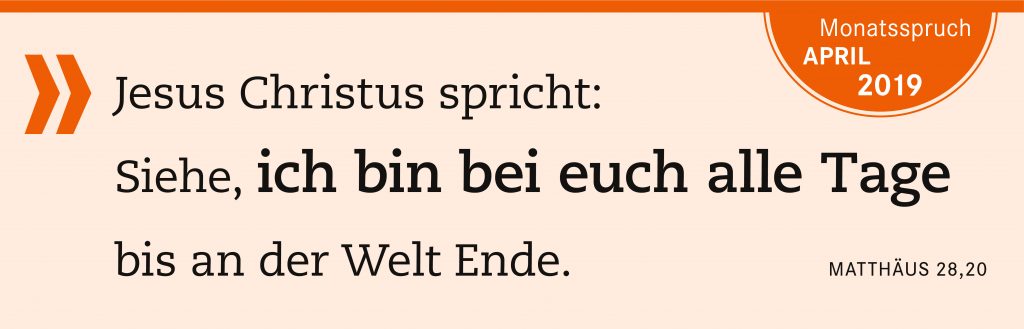
Jesus weist einen Weg
Abschiedsmomente, unwiderruflich. Überschrieben mit einem großen: Nie wieder. Nie wieder einander in die Augen sehen. Nie wieder Worte wechseln. Fragen, die ohne Antwort bleiben. Was bleibt? Wohin mit der Liebe, die noch gelebt werden wollte und will? Wohin mit den Worten, die gesagt werden und den Gesten, die gezeigt werden wollen. Das Matthäusevangelium führt vor Augen, wie Jesus Abschied nimmt. Da ist es, als tröste er seine Jünger, bevor er sie für immer verlässt.
Das wird ihre Trauer nicht verschwinden lassen. Sie lässt sich ja nicht überspringen. Aber Jesus weist einen Weg, wie sie sich überleben lässt. Ich bleibe, sagt er, auch, wenn ich gehe. Auf eine andere Weise bin ich dann nah. Bin da, wenn ihr miteinander esst und euch erinnert an mich. Und eure liebevollen Worte, eure zärtlichen Gesten: sie müssen nicht ins Leere gehen. Sie werden in euch wachsen und dann warten andere Menschen auf sie.
Manches Mal habe ich schon gespürt, wie ein Mensch nah ist, auch, wenn er gegangen ist. Was er mir bedeutet hat, bleibt in mir. Immer noch kann ein Wort trösten, das er gesagt hat. Immer noch spüre ich seine Hand stärkend auf meiner Schulter. Dann ist es, als sei er noch einmal da.
„Ich bin bei euch alle Tage“: Der Himmel, den Jesus mit sich brachte, bleibt. Mitten unter uns. Tröstend und stärkend. Er ist darauf angewiesen, dass wir ihn mit Worten und Gesten weitertragen. Bis an das Ende der Welt.
Tina Willms
„Der Gemeindebrief“
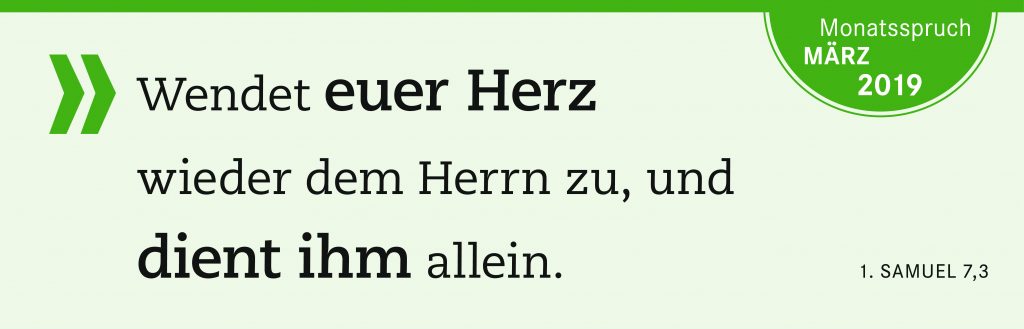
Gott ist die Nummer eins
Welche Konsequenzen hat es, wenn wir Gott unsere Herzen zuwenden und ihm allein dienen? Damals zur Zeit des Samuel bedeutete das für die Israeliten, dass sie ihre Götterfiguren von Baal und Astarte wegwarfen und nur noch den unsichtbaren Gott verehrten, der sie aus Ägypten befreit und in das Land Israel geführt hatte. Um 1070 vor Christi Geburt wurden die Israeliten häufig von dem Nachbarvolk der Philister angegriffen und erlitten herbe Niederlagen. Deshalb empfahl Samuel, der Gottesmann und Führer des Volkes, den Israeliten, dass sie ihre ganze Kraft wieder allein aus ihrem Glauben an den wahren Gott schöpfen. Und tatsächlich fanden die Israeliten nach ihrer Bekehrung wieder zu ihrer Kraft und lebten mit ihren Nachbarvölkern in Frieden.
Und 2019? Der christliche Glaube mit seinen jüdischen Wurzeln verliert in unserer Gesellschaft zunehmend an Kraft. Er scheint zu verdunsten. Wir erleben: Wo der Glaube an Gott schwindet, machen sich andere Götter breit. Das Ego und das Geld bekommen Macht. Eigensucht und Ellenbogenmentalität sind die Tugenden dieser Götzen. Barmherzigkeit wird als Naivität ausgelegt, der Schwache wird ausgegrenzt und der Ehrliche wird zum Dummen. Wollen wir so leben? Im ständigen Wettkampf und Kleinkrieg, wo keiner dem anderen mehr vertrauen kann?
Ich meine, es ist höchste Zeit, dass wir Gott wieder die Nummer eins sein lassen. Denn bei Gott ist „die Quelle des Lebens“ (Psalm 36,10).
Reinhard Ellsel
„Der Gemeindebrief“
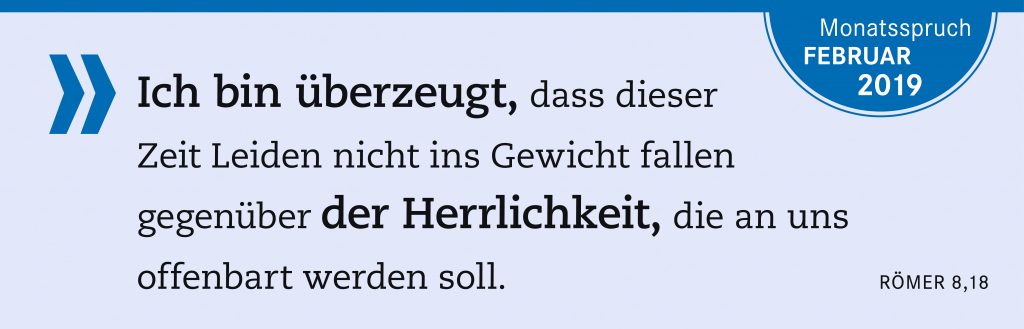
Über den Tellerrand hinaus
Wie geht es Ihnen? Manche antworten ausweichend: „So lala.“ Ich stelle mir eine Waage vor. In die eine Waagschale lege ich das Erfreuliche und in die andere Waagschale das Belastende. So wäge ich ab, wie es mir zurzeit geht.
So macht es auch der Apostel Paulus. Belastend ist für ihn, dass er wegen seines Glaubens an den auferstandenen Jesus Christus Ärger am Hals hat. Aber er sagt: „Das fällt nicht ins Gewicht!“ Denn in der anderen Waagschale ist das ewige Leben bei Gott. Diese Herrlichkeit wird ihm, so ist Paulus überzeugt, eines Tages geschenkt, weil er mit dem Auferstandenen verbunden ist.
Deshalb erfüllt den Apostel eine große Vorfreude. Und immer wieder macht er schon jetzt die beglückende Erfahrung, dass sich einige dem neuen Leben mit Jesus Christus anschließen. Und was ist mit uns?
Der Schriftsteller Heinrich Böll hat einmal das neue Leben mit einem Schmetterling verglichen, der sich aus einer Raupe entpuppt. „Wenn die Raupen wüssten, was einmal sein wird, wenn sie erst Schmetterlinge sind, sie würden ganz anders leben: froher, zuversichtlicher, hoffnungsvoller.“ Auch für Böll ist der Tod nicht das Ende. Der Glaube schenkt ihm einen ermutigenden Blick über den Tellerrand seines irdischen Lebens hinaus: „Das Leben endet nicht, es wird verändert.“ Wie Paulus räumt auch Böll dem Belastenden nicht zu viel Gewicht ein, denn: „Der Schmetterling erinnert uns daran, dass wir auf dieser Welt nicht ganz zu Hause sind.“
Reinhard Ellsel
„Der Gemeindebrief“

Gott baut uns Brücken
Schillerndes Gelb, Orange und Rot am Himmel, bis hinein ins Violett. Ein Regenbogen. Er hat für viele Menschen etwas Faszinierendes, Bezauberndes. Wenn ich einen sehe, geht mir ein Märchen im Kopf herum. Da ruhen die Enden des Regenbogens in goldenen Schalen. Wer sie findet, darf sich glücklich schätzen.
Gerade bin ich an einem gewittrigen Sommertag mit meinem Sohn unterwegs gewesen. Und schon war er da: Der Bogen, ganz klar und vollständig. „Los, Mami“, sagt mein Großer, „lass uns zum Anfang des Regenbogens fahren, heute finden wir die goldene Schale.“ Habe ich meinen Kindheitstraum so auf ihn übertragen, dass er mit seinen fast 30 Jahren noch nach den goldenen Schalen aus dem Märchen sucht?
Die Bibel erzählt auch eine Geschichte vom Regenbogen. Gott setzt ihn an den Himmel, nachdem die Sintflut vorbei ist. Seitdem ist der Regenbogen ein Zeichen. Er ist wie eine Brücke zwischen Gott und den Menschen. Eine Brücke, die nie mehr zerbrechen soll. Ein Bund, der geschlossen wird, ein für alle Mal. Im 1. Buch Mose verspricht uns Gott: „Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde.“
Vielleicht sind die Brücken, die Gott uns baut, der Bund, den er mit uns Menschen schließt, die goldenen Schalen, die Glück und Segen verheißen. Sogar große Kinder halten danach Ausschau. Nicht nur an Sommertagen.
Carmen Jäger
„Der Gemeindebrief“
